Thomas Franke und die Kunscht (Interview)
Michael Schmidt: Hallo Thomas, Wodka
oder Wasser?
Thomas Franke: Keines von beiden, denn eigentlich ist ja beides Wasser: bei dem Wort „Wodka“ (водка übersetzt: „Wässerchen“) handelt es sich um eine hinterlistige Verniedlichung des Wortes „Woda“ (Вода), das übersetzt „Wasser“ heißt. Trotzdem ich ein paar Jahre solches gezwungenermaßen oder aus Übermut freiwillig in den Hals kippend in verschiedenen Ländern mit slawischer Kultur lebte, trinke ich lieber Bier. Ich bevorzugte schon immer Bier als Schlappergetränk, denn es handelt sich dabei um eine schwach alkoholische Flüssigkeit, die den Durst löscht.
Eingedenk
des Befehls von Wilhelm Busch: „Die erste
Pflicht der Musensöhne ist,
daß man sich ans Bier gewöhne“, unterwarf ich mich diesem. Ich war wohl vier
oder fünf Jahre jung, als meine Eltern auf unserem damals wunderschönen DDR-Grundstück
eine Fete mit den Familien der Musikanten-Big-Band meines Vaters veranstalteten,
der diesen Spruch mit großer Hingabe und kalligraphisch sehr akribisch an eine Innenwand
unserer Garage pinselte. Am Morgen nach der Fete standen noch ein paar halbvolle
Gläser mit schalem Bier auf den Tischen, meine Eltern schliefen – und ich
unternahm unbeobachtet meinen ersten Schritt, Wilhelm Buschs Weisung zu befolgen.
Michael Schmidt: Köthen ist laut
Wikipedia die Welthauptstadt der Homöopathie, gehört zum Landkreis
Anhalt-Bitterfeld. Bei Bitterfeld denke ich immer an Chemieindustriebrachen.
Bonn als Synonym für bundesrepublikanischen Mief vor der Wende. Sind natürlich
Klischees, aber beide Standorte sind in deiner Vita vorhanden. Wie prägend ist
so ein Unterschied oder ist es am Ende gar keiner?
Thomas Franke: Köthen wurde erst nach
der Mauerumschubserei und der sich anschließenden Kolonialisierung durch den
Westen Deutschelandes zur Hauptstadt der Homöopathie. Die Kommandozentrale dieses
dubiosen homöopathischen Weltärzteverbandes liegt heute übrigens gegenüber der
Schule, in der ich mein Abitur bestand, in der Köthener Wallstraße. Als ich
dort herumschülerte, war jedoch noch nichts von dieser Kommandozentrale zu
sehen, sondern im Dachgeschoß des wendefolgend abgerissenen Hauses lebte mein
Gitarrenlehrer. Köthen war zur DDR-Zeit als Bachstadt und als Wohnort des Vogelkundlers
Johann Friedrich Naumann (1780 – 1857) bekannt, der sich als erster
wissenschaftlich mit einheimischen Vogelarten beschäftigte (wir pubertierenden
Schüler nannten ihn den Vögel-Naumann, denn er zeugte wohl 13 Kinder mit seiner
Frau).
Selbstverständlich prägte meine
Lebensumgebung in der DDR meine gesellschaftsbezogene Haltung sowie meinen
beruflichen Werdegang. Viele meiner damaligen Freunde waren Arbeiter, Bauern,
Friseure (damals hatte ich lange, lange Haare und einen Bart wie Billy Gibbons
und war auf Friseure angewiesen), bis ich um 1972 herum auch plötzlich Freunde
unter den SF-Schriftstellern der DDR wie der Welt fand, Künschtelern der
Bildmacherei wie der Musicke und unter den Verlagsmitarbeitern; ich konnte
meinen kreativen Begabungen nachgehen und mich darinnen suhlen, ohne an Geld
denken zu müssen, konnte Pläne schmieden und erleben, wie sie dem Brechtschen
Axiom folgend scheiterten…, - und ich lebte nicht in einer Chemiewüste, sondern
im Grünen, in einer von der Landwirtschaft dominierten Gegend dieser Welt
(siehe die angehängten Fotografien). Ich stand mit Schweinen und Rindern,
Füchsen und Hasen, Katzen und zufällig mir begegnenden Rehen sowie mit in der
DDR stationierten Soldaten und Offizieren der Roten Armee auf Du und Du. Als
ich 1984 plötzelichst im Westen Deutschelandes leben mußte, weil ich auch einem
Stasi-Mitarbeiter das Du angetragen hatte – zuerst lebte ich in München (teures
Pflaster), einige Zeit später dann in Bonn (damals nicht ganz so teures
Pflaster und für einen Künschteler leidlich finanzierbar) –, verlor ich alles
das. Ich mußte mit der spießigen Überheblichkeit der Westler und Westlerinnen
gegenüber einem DDRler, mit deren kleinbürgerlicher Arroganz, mit permanenten
Demütigungen aggressiv ausufernder Ignoranz gegenüber den künschtelerischen, überhaupt
den kreativen Berufen zurechtkommen und hechelte der Sicherung meiner Existenz
hinterher, indem ich profanen Berufen nachging, welche mir meine Persönlichkeit
zerfetzten und meine künschtelerische Entwicklung erschwerten. Wie prägend dieser
Unterschied sich in der Realität auswirkte? In der DDR konnte ich wochenlang
über einer Zeichnung brüten, ohne mir Gedanken um das Geld für die Miete, Speis
und Trank machen zu müssen, im Westen Deutschelandes war ich gezwungen,
Bildnerisches im Rutziputzi-Verfahren herzustellen und nebenbei mit Brüllikram bekannt
und eventuell sogar berühmt zu werden, damit ich mein Bildnerisches für viel
Geld an die Leute bringen konnte, wenn ich von meinen Berufen leben wollte…, -
und so weiter und so fort. Hauptsächlich war ich jedoch damit beschäftigt,
Administratives zu erledigen, Ämterbefehle zu befolgen und das Geld für die elend
teure Miete samt Nebenkosten zu erwirtschaften, die ich für eine Karnickelbunde
berappen mußte. Ich wechselte also von meinen filigranen Bleistift- und punktierten
Tuschezeichnungen zu Holzstichcollagen, die sich viel, viel schneller
zusammenbasteln lassen. Ich darf nicht vergessen zu erwähnen, daß die Unterhaltungen
und die Diskussionen mit Menschen und Tieren zu meiner DDR-Zeit künschtelerisch
sich anregender und aufregender auf meine Arbeit auswirkten als die im Westen
geführten, die viel zu oft kleinbürgerlich-vorurteilsgesättigte Klischees zum
Inhalt hatten, die mir fremd waren und die ich bis heute nicht begreife und
demzufolge nicht gerne führe. Dialektische Zusammenhänge oder bereichernd auf
meine künschtelerische Arbeit Wirkendes folgten daraus nicht, sondern es
sammelte sich ein Misthaufen Entfremdungen an; - es gelang mir nicht, mich je
wieder irgendwo zu Hause zu fühlen. Nicht einmal in Köthen, wo ich mit meiner
Liebsten im Juli dieses Jahres zu Besuch war.
Michael Schmidt: Ich habe mal einen
Text von dir gelesen, der war doch etwas schwer zugänglich. Andererseits
illustrierst du die Herbert W. Franke Werksausgabe und der war eher nüchtern in
seiner Ausdrucksweise. Sind da verschiedene Herzen in deiner Brust? Deine
Collagen auf der Franke Werksausgabe wirken einerseits technisch-funktionell,
andererseits doch abstrakt.
Thomas Franke: Wir beide entdeckten
ja, daß es sich bei diesem Text um den narrativen Essay „Zone und Null“
handelte, den ich für Herberts Roman „Zone Null“ geschrieben hatte, - ein
Roman, der mich sehr beeindruckte und mein Denken beeinflußte, als ich ihn Ende
der siebziger Jahre des letzten Jahrhunderts noch in der DDR lebend las. Den
narrativen Essay „Zone und Null“ schrieb ich speziell für den in der
Herbert-W.-Franke-Science-Fiction-Werkausgabe erschienenen Band „Zone Null“ und
er wurde in „Gegen Unendlich #12 – Phantastische Geschichten“ nachgedruckt. Der
Mitherausgeber dieser Erzählungensammlung Andreas Fieberg schreibt im Vorwort:
„Er [das bin ich] schildert – nicht ohne selbstironisches Pathos – die
hochfliegenden und letztlich enttäuschten Hoffnungen, die er noch zu DDR-Zeiten
mit dem Auftrag verband, Vignetten für die Erstveröffentlichung von Herbert W.
Frankes Roman „Zone Null“ gestalten zu dürfen.“ In diesem Essay schrieb ich mir
also die Erlebnisse dieser Zeit gleichnis- und märchenhaft von der Seele, die
ich als Künschteleler im Zusammenhang mit meiner Bebilderungsarbeit, nicht nur
hinsichtlich einiger Vignetten, sondern auch größerer Grafiken für Bücher von
Herbert W. Franke erarbeiten und veröffentlichen zu können, durchstehen mußte.
Der Text ist gewiß nicht ohne umfassendere Literaturkenntnisse – nicht nur umfassende
Kenntnisse phantastischer, sondern auch angrenzender literarischer Genres –,
ohne eine gewisse Beschlagenheit in griechischer Mythologie, in christlicher
Ikonografie und ein wenig Wissen bezüglich meiner individuellen künschtelerischen
Orientierung zu verstehen. Als Herbert W. Franke den Essay gelesen hatte,
schrieb er mir übrigens dazu: „Ein großer Teil Ihrer Ausführungen haben mir
aber auch neue Kenntnisse über Ihren Weg und Ihre Aktivitäten gebracht, und in
dieser Hinsicht ist Ihr Anhang „Zone und Null“ natürlich höchst aufschlußreich
– der im Übrigen auch literarisch bemerkenswert ist.“
Du solltest bedenken, daß meine Bilder
nicht zu trennen sind von den Titeln, die ich für sie dichte; diese Titel
findet man beispielens in den Büchern der
Herbert-W.-Franke-Science-Fiction-Werkausgabe, in welche die Gesamtmotive – oft
als mehrseitig ausfaltbare Frontispize – eingebunden wurden. Die für die Cover
verwendeten Motive bestehen nur aus jeweils einem Ausschnitt aus der gesamten
Grafik, den ich schon während der Arbeit an der jeweiligen Holzstichcollage als
solch ein mögliches Covermotiv konzipierte. Die Gesamtmotive habe ich ergo so
entworfen, daß der jeweilige Auswahlteil jedes Motivs als vollwertiges
Covermotiv existieren kann.
Besonders in den frühen Zeichnungen
und in einigen der gegenwärtigen Holzstichcollagen zu den Werken von Herbert W.
Franke ist zu beobachten, wie der Stil von Herbert W. Frankes literarischem
Werk meine naturwissenschaftlichen Interessen im Dialog mit diesem hervorkitzelte,
was jene – wie Du sie nennst – technisch-funktionellen, abstrakten Motive erzeugte;
allerdings fasziniert mich die Verwendung technischer Zeichnungen im
Zusammenhang mit gegenständlichen Details grundsätzlich. Meine erste Idee für
die Gestaltung der Franke-Werkausgabe bestand aus der Vision, Blaupausen als
Basismotive zu verwenden. Weil ich nicht genügend unterschiedliche Blaupausen
auftreiben konnte, entschied ich mich schließlich für die Schriftbasis, auf
welcher die Titelei und die Vignette sitzen. Aufgrund der Kombination alter
technischer Zeichnungen und abstrakter Motive mit gegenständlichen
Holzstichmotiven wurden diese meine Bilderchen dem Steampunk angewanzt, als
dieses Genre zeitgeistig war, – eine kurzlebige Modeerscheinung wie so vieles
in der Kunscht. Ich sah das nie so. Diese Zuordnung entstand wohl hauptsächlich
deswegen, weil ich für meine Collagen alte Holzstiche aus Zeitschriften und
wissenschaftlichen Kompendien des neunzehnten, Anfang des zwanzigsten
Jahrhunderts verwendete. Damals gab es keine andere Möglichkeit, als Bilder in
Zeitschriften und wissenschaftlichen Büchern von strapazierfähigen Holzstichblöcken
zu drucken.
Seit Anfang dieses Jahrtausends ist die Holzstichcollage mein
bevorzugtes Medium, das mir durch die Nähe zum Surrealen, Dadaistischen,
Phantastischen aus der Perspektive der Technisierung in unserer heutigen Zeit,
in welcher das menschliche Individuum zunehmend zum Teil einer riesigen
Maschinerie sich entwickelt, die
Schaffung einer dystopischen Welt aus
einem ironischen Blickwinkel ermöglicht, den ich oft darauf werfe und
provokativ artikuliere, wozu diese aufgrund der Verwendung alten Bildmaterials
rückwärts gerichtet scheinende, dennoch gegenwärtig oder gar zukünftig
anmutende Verbindung der Details sich herrlich eignet. Wolfgang Jeschke schrieb
in einem Essay für den Katalog, der anläßlich einer Ausstellung meiner
Machwerke in Köln erschien: „Was die Science Fiction, ja die Phantastik
allgemein betrifft, ist Thomas Franke der Künstler, der dem Kern des Phänomens
am nächsten kommt. Seine Collagen treffen ins Schwarze. Es ist ein weit
verbreiteter Irrtum, Science Fiction stelle Zukunft dar ... nein, sie montiert
realistische Details der Gegenwart und Vergangenheit auf neue Weise zu
ungewohnten Ensembles zusammen, die Aufmerksamkeit erregen und den Blick
schärfen, der vom längst Gewohnten eingelullt, aus der Lethargie gerissen
werden soll, weil sich plötzlich mehrere alternative Wirklichkeiten
übereinander projiziert darbieten, um Aufmerksamkeit zu wecken, zu frappieren
und zu neuen Sichtweisen zu zwingen, Unruhe zu stiften und Unsicherheit zu
verbreiten, zum Hinterfragen des Gegebenen herausfordern.
Und genau das tun die Collagen von Thomas Franke auf ihre
friedfertige und doch beunruhigende Weise.“
Die Technik der Holzstichcollage hatte
mich übrigens schon zu der Zeit außerordentlich gereizt, als ich noch in der
DDR lebte. Schon als Knirps im Alter von fünf Jahren war ich von diesen
feinstricheligen Abbildungen fasziniert, die ich damals auf den Bildtafeln in
zwei Bänden von „Meyers Konversationslexikon“ aus dem Jahre 1899 selbstversunken,
also weltabgeschieden immer wieder betrachtete, welche meine Eltern im
Bücherregal stehen hatten. Und schon damals juckten mir die Flingerlingerchen,
diese Bücher auseinanderzunehmen, die Holzstichmotive auszuschneiden und zu
neuen Bildern zusammenzufügen, obwohl ich noch überhaupt nichts von der
Collagen-Technik wusste. Nun ja: auch die Achtung, die ich meinen Eltern
entgegenbrachte, hielt mich zurück, diese Bücher für meine Ideen zu zerstören.
Immerhin trug die Faszination am fein Gestrichelten mit Sicherheit dazu bei, daß
ich später, als Grafiker, eine ebensolche filigrane Technik für meine
Zeichnungen wählte. Da kannte ich aber die Arbeiten Max Ernsts schon und hatte
zudem die Historie der phantastischen bildenden Kunscht eingesaugt; ungefähr 1978,
während meines Studiums der Malerei und Grafik, hatte ich in einer
Fachzeitschrift des Verbandes Bildender Künstler einige Holzstichcollagen
dieses seitdem von mir sehr verehrten Künstlers gesehen und spürte eine mich
verunsichernde Seelenverwandtschaft: Die Suggestionskraft solcher Werke
verwirrte meine Sinne wie unmäßig viel gesoffener Wodka - und sie erwiesen sich
dann auch als Droge. Aber es brauchte noch den Wechsel in den Westen, den
Existenzdruck (denn mit meiner zeitlich sehr aufwendigen bleistiftgestrichelten
und der mit Tusche gepünktelten Technik wäre ich hier verhungert) und die
Möglichkeiten des Internets, wo ich alte Bücher mit Holzstichbildern preiswert
ersteigern und kaufen konnte, um solche Grafiken entstehen zu lassen, wie ich
sie derzeit für meine Buchgestaltungen schaffe. Übrigens: die beiden
Lexikon-Bände meiner Eltern zerlegte ich viele Jahre später dann doch noch, -
mit ihrer Erlaubnis!
Ach ja, meine Eltern: Meine Eltern
ängstigten sich aufgrund meiner kreativen Talente, daß ich eines Tages als
Künschteler den Kitt aus den Fenstern fressen müßte (was ja auch geschah,
nachdem ich mich im Westen Deutschlands dem kapitalistischen Wertekanon, mithin
der Diktatur des Geldes unterwerfen mußte), weswegen sie alles unternahmen,
meine naturwissenschaftlichen Interessen zu fördern. Und so geschah es, daß ich
1974 das Studium der Physik begann, - und diese Facette meiner Persönlichkeit
findet sich als Ergebnis meiner Überlegungen zur Inhalt-Form-Beziehung in einigen
technisch-funktionellen und abstrakten Arbeiten wieder.
Als ich künschtelerisch zu arbeiten
begann, schuf ich kleinformatige, minutiöse, sehr aufwendig erarbeitete
Bleistift- und Federzeichnungen. Und aufgrund meiner Verquickung in die
Literaturszene der DDR, deren Dazugehörende meine Arbeiten als an- und
aufregend empfanden, trat 1977, schon während meines Kunststudiums an der Burg
Giebichenstein in Halle, der Ostberliner Verlag Neues Leben an mich heran und vereinbarte
mit mir erste Gestaltungsaufträge für Bücher des phantastischen und
Science-Fiction-Genres. Man meinte, nicht nur meine Art zu zeichnen, sondern
auch mein Interesse für die Naturwissenschaften, insbesondere für die Physik
und die Astronomie, prädestinierten mich für dieses Genre, das im Osten als „wissenschaftliche
Phantastik“ bezeichnet wurde. Allerdings waren meine für solche Bücher
geschaffenen oder genutzten Werke nie gebrauchsgrafische Illustrationen,
sondern alle Arbeiten erzählten eigene, von dem jeweiligen literarischen Text
angeregte Geschichten und Ereignisse, von denen ich meinte, daß sie sich in dieser
geschilderten Welt so ereignet haben könnten. Ich abstrahierte Inhalte und ließ
sie zu bildlichen Metaphern, Symbolen, Parabeln oder Allegorien gerinnen. Meine
Zeichnungen und Grafiken vermochten also für sich zu stehen, weil ich mich für
ihre Gestaltung immer wieder von der christlichen und von der Ikonografie der
griechisch-römischen Mythologie anregen ließ und selbstverständlich
Inspirationen aus der klassischen Literatur der Romantik verwendete,
insbesondere aus Erzählungen E. T. A. Hoffmanns (als Beispiel will ich die
Erzählung „Der Sandmann“ mit der menschlich anmutenden Puppe Olimpia erwähnen,
die Hoffmann „die Automate“ nennt), den Romanen Jules Vernes oder auch Karel Čapeks.
Diese Nähe zur Literatur, welche ich auch in meinem zweiten Beruf als
Schauspieler pflegen mußte, ließ mich schließlich die Werke zuvörderst der
Schriftsteller des Magischen Realismus entdecken, und hier besonders das
Œuvre
des Argentiniers Jorge Luis Borges, der sich, ob seiner umfassenden Bildung
nicht nur von mir hochverehrt, nach und nach als Initiator einer neuen Art und Weise meines Umgangs
mit den Künschten und meines diesbezüglichen Selbstverständnisses erwies,
nachdem ich die DDR verlassen hatte. Aus meiner tiefreichenden Verunsicherung,
mit der ich in der Folge meines Hinauswurfs aus der DDR zu kämpfen hatte, aus
der Auflösung ethischer, moralischer, überhaupt weltanschaulicher Ansichten und
Orientierungen, entstand die Notwendigkeit, sowohl mich als auch mein Kunschtverständnis
neu aufbauen zu müssen, und während meiner Suche rückte mir Borges als
Verwandter im Geiste nahe, als der „…vielleicht größte Lehrer und Meister der
Wahrheit wie der Lüge, Ketzer und Gläubiger, Gott und Teufel in einer Person.“ (Martin Gregor-Dellin)
Einige Beispiele meines
bildkünstlerischen Schaffens, die über technisch-funktionelle und abstrakte
Motive hinausgehen, können Interessierte auf dieser Seite im Internetz
anschauen, die ich zu meinem großen Bedauern aufgrund des großen Berges Arbeit,
der vor mir liegt, nicht weiterzupflegen schaffe: https://www.flickr.com/photos/157472105@N05/
Michael Schmidt: Kanntest du Herbert W. Franke persönlich?
Thomas Franke: Ich entschuldige mich
an dieser Stelle bei den älteren Lesern dieses Interviews, die diese Geschichte
kennen, weil ich Sie schon des Öfteren erzählen mußte: Herbert und ich begegneten einander zum ersten Mal im Jahr 1976, auf dem Eurocon im polnischen
Poznań. Ich hatte damals trotz aller diesbezüglicher Erschwernisse – ich lebte
ja noch in der DDR - schon seinen Roman "Zone Null" sowie die
Kürzestgeschichtensammlung "Der grüne Komet" gelesen, die erste
Schneckerlinge und Schnauckbartraupen sowie weiteres eklektizistisches, marodes
Ungeziefer durch meine Visionen hetzen ließen, und mich zu jenen morbiden
Grafiken reizten, für die ich bekannt werden sollte, und blickte zu ihm auf mit
jener Schwärmerei, mit der man halt als Zweiundzwanzigjähriger die Objekte seiner
kreativen Begierden anhimmelt. Ich war mit übermächtiger intellektueller wie
schöpferischer Gier nach Inschpiratzion zu dieser Juropieen Szaienz Ficktschen
Conventschen gereist, einige meiner frühen punktierten Federzeichnungen... nun
ja: konspirativ am Mann, weil ich sie dort nicht ausstellen, sondern nur
herumzeigen durfte. Über das beständige Herumzeigen kamen wir ins Gespräch.
Ich erinnere mich amüsiert jenes Wortwechsels, während dessen Herbert mich
fragte: „Wie war doch gleich Ihr Name?“ Und als ich antwortete: "Franke,
mein Name ist Franke", entgegneten er verlegen giggelnd: "Ach ja, -
ein Name, den man sich schlecht merken kann."
Anschließend kamen wir überein, ein
paar meiner Federzeichnungen als Illustrationen in einem Band der Heyne-Reihe
"Science Fiction Story Reader" zu drucken (ein wenig bekannt als
Grafiker des Phantastischen war ich seinerzeit im westlichen Teil Deutschlands
schon, weil ich der Zeitschrift "EXODUS" Grafiken zur
Veröffentlichung überlassen hatte, die damals ein gieriges Rufen nach mehr bei den SF-Fans erzeugten) und im darauf
folgenden Jahr 1977 erschienen im von Herbert W. Franke herausgegebenen
"Science Fiction Story Reader 8" vier Grafiken von mir, dem weitere
Veröffentlichungen in den Ausgaben 9 und 10 folgten. 1978 beauftragte mich der
DDR-Verlag „Das Neue Leben, Berlin“ schließlich mit der Illustration seines
Romans „Ypsilon minus“, der als Lizenzausgabe dort erschien - und den Suhrkamp
Verlag auf meine bildkünschtelerischen Arbeiten aufmerksam werden ließ, für
dessen von Franz Rottensteiner herausgegebene „Phantastische Bibliothek“ ich
dann zwischen 1979 und 1983 fünfzig Bände mit meinen Vignetten gestaltete.
Während der folgenden Jahre führten Herbert
und ich eine manchmal sehr rege Korrespondenz, bis ich am vierten März 1984, der
Tag meines Hinauswurfs aus der DDR, im bisher als schrecklichstes von mir erlebten
Morgengrauen mit verheulten, auch vom voralpischen Schneetreiben geröteten
Augen in Egling vor seiner Haustür stand und mit meiner damaligen Frau drei
Tage bei ihm herumlungern durfte.
Als ich im Westen Deutschlands unter
kapitalistischen Bedingungen lebend und finanziell von existentiellen Zwängen
gegängelt nicht nur meine bildkünschtelerische Arbeit betreffend, sondern auch
meine Weltsicht und das kulturelle Interesse verändernd, mich von der Science
Fiction entfernte, reduzierte sich unser Kontakt auf eher zufällige Begegnungen,
bis ich auf seinen Wunsch hin im Jahr 2014 die Science-Fiction-Werkausgabe für p.machinery
zu gestalten begann.
Erst anderthalb Jahre vor seinem Tod
bot er mir das „Du“ an.
Michael Schmidt: Du wolltest Astronom
werden, bist dann aber ans Theater gegangen. Science-Fiction ist ja auch das
Spiel mit der Phantasie und technischer Grundlage. Wie kreativ ist die
Science-Fiction?
Thomas
Franke: Damit hast Du salopp über vieles hinweg hüpfend meinen beruflichen
Werdegang verkürzt (kicher!). Als ich 17 Jahre jung war (es ist witzig: wenn
man die Zahl umdreht, hat man mein gegenwärtiges Alter!), wollte ich
tatsächlich Astronom werden, wozu ich Festkörperphysik hätte studieren müssen.
Aufgrund meiner Ruppigkeit, weil ich politisch-ethisch nicht in eine Schublade
einsortiert werden konnte und weil in der DDR nur fünf Astronomen jährlich
gebraucht wurden, erhielt ich keine Zusage für diese Studienrichtung und man
empfahl mir das Studium der Physik mit dem Berufsziel, Lehrer für dieses Fach
zu werden. Dieses erinnere ich noch
anhand eines lange zurück liegenden
scheppernden Steinwurfechos – und ab und zu
denke ich darüber nach wie es gelaufen wäre, wenn mein Leben sich nicht so
entwickelt hätte, wie das Schicksal es für angemessen hielt. Oder ein
Teufelchen. Oder ein Raunen, das tief aus meinem Unterbewußtsein flüsternd mich
schubste. Beinahe wäre ich also Physiklehrer geworden, was ich in Halle zu
studieren begann. Auf dem Weg zur Universitätka fuhr ich täglich mit der
Straßenbahn an der "Burg Giebichenstein" vorbei, bis ich es nicht
mehr ertrug, die Leute mit den großen Grafikmappen unterm Arm auf dem Trottoir
vor der Kunschthochschule entlang stolzieren zu sehen. Ich wollte ebenfalls mit einer Mappe unter dem Arm dort
herumstolzieren, weswegen ich mich an der „Hochschule für industrielle
Formgestaltung“, wie sie damals hieß, bewarb, im freien Fachbereich Malerei und
Grafik zu studieren, - und die Naturwissenschaften in die Saale warf, denn ich
wurde angenommen. Weil mein Interesse schon sehr früh der
Symbiose bildender Kunscht mit der Literatur gehörte, durfte ich als praktische
Diplomarbeit ein Bühnenbild zu Brechts Stück „Herr Puntila und sein Knecht
Matti“ erarbeiten,- neben der theoretischen über das Spezifische phantastischer
Metaphern, Symbole und Allegorien im Werk von Hieronymus Bosch, Francisco de
Goya und Max Klinger. Als das Bühnenbild aufgebaut wurde, rastete ich auf den
Brettern aus, welche angeblich die Welt bedeuten sollen, und brüllte die
Bühnenarbeiter an, weil sie die Seiten des Bühnenbildaufbaus vertauscht hatten,
nicht ahnend, dass gerade jemand heimlich in der Technik eine Flasche Whisky
süffelte und mir zuschaute. Der wollte mich später in der Kantine sprechen: ein
kleiner, kompakter, mir damals völlig unbekannter Mann mit dicken
Brillengläsern und einem wundervoll geschnittenen Kaschmirmantel; und der
beschwätzte mich, dass ich zusätzlich noch darstellende Kunst studieren müsste,
denn ich hätte eine unglaubliche Bühnenpräsenz, die man nicht erlernen könnte, weil
sie einem vom Theatergott in die Wiege gelegt worden wäre. Mir würde es jedoch
an Technik mangeln, denn wie ich feststellen müßte, wäre ich beim Schreien
heiser geworden. Einige Monate später studierte ich die
darstellende Kunscht, ging als Austauschstudent für das Charakterfach-Studium
nach Moskau – damals noch in der Sowjetunion gelegen –, wo ich an der „Russischen
Akademie für Theaterkunst“ (GITIS) mein Diplom als Staatsschauspieler ablegte.
(Wozu diese beiden Studiengänge und die dabei erworbenen Diplome gut sind, fand
ich im Goldenen Westen nie heraus; hier wurden ja beide Berufe während der Zeit
der Coronadiktatur endgültig als systemunrelevante definiert.)
Das
Interesse für die Wissenschaften nistete sich jedoch in meinem Kopf ein und
wahrscheinlich fühlte ich mich deswegen zur Science Fiction wie zur
wissenschaftlichen Phantastik hingezogen.
Über
Deine Frage, wie kreativ ist die Science-Fiction ist, dachte ich lange nach,
kam jedoch zu keinem mich selbst überzeugenden Ergebnis, weil dieses
Literaturgenre mich nur während meiner Kindheit und als Jugendlicher zu
faszinieren vermochte und sich in späteren Jahren nach und nach verflüchtigte.
Nach meinem fünfundzwanzigsten Lebensjahr ungefähr hatte ich mich in das Werk
von Schriftstellern eingelesen, die … nennen wir es genreübergreifend
„Phantastisches“ schrieben. Kreativität, also schöpferische Kraft, kann nicht
einem künschtelerischen Genre zugeordnet werden. Sie ist kausal den Menschen zu
eigen, nur treibt sie den einen stärker als einen anderen an, sie zu
gebrauchen.
Was nun die Kreativität bezüglich der
Science Fiction angeht, so beobachte ich, daß diejenigen, die sich damit
beschäftigen, sehr kreativ beim Erfinden und Einhegen von Mikrogenres sind. Recht
spießig hieß eine solche Literatur früher phantastische oder
wissenschaftlich-phantastische Literatur, danach bezeichneten wir sie als Hard
Science Fiction, zu welcher beispielsweise die Space Opera und die Military SF
gehörten, nicht zu vergessen die Soft-Science-Fiction, und als diese Genres
merkantil nicht mehr so gut funktionierten, erfand man die Genres Dystopie, die
oft in eine Postapokalypse überging, angelehnt an gegenwärtige Entwicklungen in
der Wissenschaft wie in der Gesellschaft den Cyberpunk, den Hope Punk,
Steampunk und Rocketpunk und so weiter und so fort. Es wurde noch nicht zu Ende
erfunden. Resümierend möchte ich auf die vorher in diesem Interview
zitierte Äußerung Wolfgang Jeschkes verweisen; Science Fiction schrappt oft näher an der
Realität, als man denkt. Gegenwärtig schieben sich Digitalisierungsprozesse ins
menschliche Leben – und viele Science-Fiction-Schreibende verlegen die
erzählten Geschehnisse in solche Welten. Ich empfinde solche Geschichten oft
als Gegenwartsliteratur on the edge. Ich vermisse den Sense of Wonder in solchen Werken (aber eventuell
bin ich hochmütig).
Michael Schmidt: Du hast für Suhrkamps
Phantastische Bibliothek gearbeitet, da warst du noch im Osten. Kannst du ein
paar Begebenheiten aus der Zeit erzählen?
Thomas Franke: Um 1977, 1978 herum gerieten mir zwei Bücher der
Reihe „Phantastische Bibliothek“ des Suhrkamp Verlags ins bewußte Dasein. Im
Frühling des Jahres 1978 trieb ich mich nämlich in Tychy, einer Stadt bei
Katowice in der Volksrepublicke Polen, herum, um im Teatr Mały eine Ausstellung
meiner Zeichnungen einzurichten. In den Pausen des Ausstellungsaufbaus
betranken wir uns, der Direktor dieser Institution, sein Adlatus und ich, mit
schlecht verschnittenem Cognac, - oder ich trieb mich im nahen Katowice herum.
Und eines Tages sah ich während des Herumtreibens in einem Buchantiquariat ein
hell-purpurfarbenes Taschenbuch mit einer dunkelblauen Vignette und gleicher
dunkelblauer Titelei, dessen Ästhetik der Gestaltung mich auf eine seltsam
lustvolle Weise aufkratzte und mich emotional tief berührte; - nein, nicht nur
tief berührte: ich erbebte physisch und emotional. Der Buchtitel war ein
deutscher, - ein deutsches Buch also, im Schaufenster eines polnischen
Antiquariats ausliegend, jedoch mit Erzählungen des damals berühmten polnischen
Schriftstellers Stanisław Lem; - das zumindest schien mir unter
den bestehenden politischen Zuständen begreiflich, denn dieses Taschenbuch war
aufgrund der Ästhetik seiner Gestaltung als ein Buch aus dem Westen
Deutschlands zu erkennen – erschienen also im Land des Klassenfeindes! - und
ich konnte es hier für ein paar staatsmonopolistische Złoty käuflich erwerben
und mit mir nach Hause nehmen. Dieses "mit mir nach Hause nehmen"
liest sich heute so leichthin, damals jedoch bedeutete es, ein Machwerk des
Klassenfeindes über die Polnisch-DDRliche Grenze zu schmuggeln, ... zu
schmuggeln (!), - sich also beim heimlichen Verbringen dieses Buches von dem
einen staatsmonopolistischen in ein anderes solches Land nicht erwischen zu
lassen. Und ich erwarb und schmuggelte es, ängstlich, nervös, innerlich
vibrierend, körperlich angespannt, durch die Filzungen polnischer und
DDheRrischer Grenzer hin ins heimatliche kleine Dörfchen. Dieses Taschenbuch
war der erste Band der "Phantastischen Bibliothek", "Nacht und Schimmel", Erzählungen des Schriftstellers Stanisław Lem: mein Schatz
seinerzeit - und auch heute noch. Das Hell-Purpur des Covers ist mittlerweile
ein wenig blasser als damals und die Buchseiten sind vergilbt, aber es bleibt
ein gänsehäutige Erinnerungen auslösendes Kleinod in meiner Bibliothek. Damals
brütete ich beinahe täglich über dem Cover dieses Buches, entfachte es doch in
mir wiederholt dieses Erbeben, das mit kreativem Schaffensdrang und der Ahnung
künschtelerischer Möglichkeiten und Zukünfte einherging, - gar nicht erst davon
zu schreiben, daß ich mir sehnlichst wünschte, diese Buchreihe, die
"Phantastische Bibliothek", gestalten zu dürfen, was noch bis zum
Spätherbst dieses Jahres als heimliche, argwöhnisch verschwiegene Sehnsucht in
mir nagte.

Das zweite Buch der "Phantastischen Bibliothek", welches
ich wenige Monate später in die Hände bekam, und das mich aufgrund der
Gestaltungsästhetik und vor allem der Titelvignette wegen laut aufjauchzen
ließ, war der dritte Band in der Reihe: Herbert W. Frankes "Ypsilon
minus“. Im Herbst 1978 klopfte nämlich der Chefgrafiker des Verlages Neues
Leben, dessen Namen ich nicht mehr erinnere, mit einem Brief bei mir an, dem
das Taschenbüchlein der Suhrkamps beilag, ob ich Interesse hätte, die in der
DDR in Lizenz erscheinende Ausgabe dieses Herbert-W.-Franke-Romans zu
begraficken. Hatte ich, reizte mich, und meine Grafickrei dazu sollten mich
berühmt machen, - sowieso! Und diese Vignette auf dem Suhrkampbuch-Cover ...
Ich kroch ins Bild hinein, breitete mich darinnen aus, leckte gierig
Inschpiratzjohn wie ein Vampir das Blut, trank das Motiv: das im dunkelblauen,
fast dunkelvioletten, purpurstichigen Schatten einer ausgestanzten Makroplatine
verschwindende Gesicht eines Menschen, der in etwas Militärisches
Assoziierendes gekleidet ist, das aus nebelig schlierendem Raum sich
materialisiert. Und während ich noch über meine Grafiken zu „Ypsilon minus“
brütete, fragte mich Hans Joachim Alpers, der damals so eine Art Agent in der
BRD für mich war, im Auftrag des Suhrkamp Verlags, ob ich die Gestaltung der
„Phantastischen Bibliothek“ übernehmen wollte, denn das Grafikerpaar, das sie
bis dahin mit seinen wunderschönen Vignetten gestaltet hatte, Hans Ulrich &
Ute Osterwalder, wollte aufhören. Meine Grafiken waren zu jener Zeit im Westen
Deutschlands schon recht bekannt, druckten doch viele Fanzines - EXODUS,
Solaris Story Reader, Phalanx, die SFT, Comet und andere, die ich mittlerweile
vergessen habe - meine Federzeichnungen, und Herbert W. Franke wie auch
Wolfgang Jeschke nutzten meine Motive als Illustrationen und Umschlag- wie auch
Covergestaltungen für die von ihnen herausgegebenen Science-Fiction-Bücher des
Wilhelm-Heyne-Verlags, Werner Zillig beim Goldmann-Verlag, Horst Heidtmann beim
Signal Verlag Baden-Baden und andere Herausgeber in Büchern anderer Verlage.
Ich sagte also dem Suhrkamp Verlag zu, dessen Chefgestalter Rolf Staudt -
damals nannten wir die Dinge, Berufe und Sachverhalte noch beim deutschen
Namen, weswegen ich auch noch kein „Artwork designte“, sondern für die
Buchcover „Vignetten zeichnete“, und Rolf Staudt und Willy Fleckhaus ganz
profan „Chefgestalter“ genannt wurden, noch nicht „Art Director“ - sofort
Kontakt zu mir aufnahm, um mir die ersten Aufträge zu übermitteln. Damals
bezahlten die Verlage noch für Buchgestaltungen und Illustrationen, und
Suhrkamp honorierte mich sehr gut. Jedoch verursachte die Honorierung meiner
Arbeit nachhaltige Folgen, da ich in der DDR lebte und das Geld nicht
problemlos auf mein Konto überweisen lassen durfte: der
Staatsmonopolkapitalismus der DDR öffnete die Pforten seiner Mühlen für mich,
denn ich mußte meine Arbeit für Buchverlage in der westlichen Hemisphäre der
Welt auf solide Füße stellen, das heißt: sie vom „Büro für Urheberrechte“
genehmigen lassen, einer Institution des Außenministeriums der DDR, dessen
Büros in einem Gebäude in Steinwurfnähe zur Berliner Mauer lagen, weswegen ich
den Grenzsoldatitschkis der NVA jedes Mal meinen Ausweis und die schriftliche
Einladung präsentieren mußte, wenn ich im „Büro für Urheberrechte“ vorstellig
wurde. Nachdem ich also die Genehmigung durchgekämpft hatte, offiziell für
Verlage der westlichen Welthemisphäre arbeiten zu dürfen, was mich übrigens
beinahe ein halbes Jahr permanenter Diskussionen und Rechtfertigungen kostete
und mir spezielle Verehrer und Interviewer von der Staatssicherheit, heute
zärtlich „Stasi“ genannt, verschaffte, war ich gezwungen, dem „Büro für
Urheberrechte“ jeden Auftrag, jede bezahlte Veröffentlichung zu melden und die
gezahlten Honorare „… zu meinen Gunsten auf das Außenhandelskonto der DDR …“
anweisen zu lassen, die ich dann im Umrechnungskurs 1:1 (auch Dollari und
Pfunde!) beantragen mußte, damit sie auf mein DDR-Konto überwiesen wurden,
wovon ich dann 25 Prozentow als GENEX-Schecks beantragen durfte. Mit solchen
Schecks konnte ich in den Intershops dort angebotenen, überflüssigen Krimskrams
westlicher, kapitalistischer Produktion käuflich erwerben: Ohdekollonje,
Conjack (den Rachenputzer „Dujardin“ beispielens!), Seife, Matchbox-Autos …, -
irgendwelche Scheiße also, bunte Glaskugeln, auf die meine DDR-Miteingeborenen
scharf waren, ich jedoch nicht. Ich hätte lieber Kupferdruckpapier, Farben,
Pinsel und hochwertige Tuschen käuflich erworben. Aber die gab es in den
Intershop-Läden nicht. Viele meiner Mitmenschen waren überzeugt davon, daß ich
die blauen Hunderter stapelweise unter meinem Bett horten würde, und es
breiteten sich, Krebswucherungen gleich, Mißgust und vor allem Neid in meinem
sozialen Umfeld als auch darüber hinaus bei Leuten aus, die mich nicht einmal
persönlich, sondern nur vom Hörensagen kannten.
Als ich dann 1984 plötzelichst im Güldenen Westen Deutschelandes
aufschlug, distanzierte sich der Suhrkamp Verlag von mir. Die Gründe dafür
servierte der bis dahin von mir verehrte Rolf Staudt in unserem letzten
Telefongespräch eiskalt nach: zum Ersten würde der Verlag die herausgegebenen
Bücher nicht für die Liebhaber meiner Covervignetten machen, zum Zweiten wäre
dem Verlag von wem auch immer mitgeteilt worden, bei einer weiteren
Zusammenarbeit mit mir keine Buchlizenzen mehr aus der DDR gewährt zu bekommen,
was man vermeiden wollte, und zum Dritten hätte der Verlag andere
hochtalentierte Gestalter gefunden. Allerdings erwies sich die dritte
Behauptung als eine, die der Verlag niemals einzulösen schaffte; nach den
außergewöhnlichen Vignettenmotiven der Ulrich/Osterwalders und den meinen fand
der Suhrkamp Verlag keinen adäquaten Gestalter mehr für die Buchreihe. Aber
auch die anderen Verlage der Bummsdesrepublicke brachen den Kontakt zu mir ab.
Ich war wohl im Osten wie auch im Westen bekannter als ich es eingeschätzt hatte
und menschlicher Opportunismus sorgte lange Zeit dafür, daß ich als Persona non
grata angesehen wurde.
Michael Schmidt: Schauspieler und
Grafiker. Geht das in einer Hand oder sind das verschiedene Persönlichkeiten in
die du schlüpfst, wenn du die jeweilige Rolle einnimmst?
Thomas Franke: Es kommt nicht auf das
künschtelerische Genre an, in welchem ich jeweils arbeite, sondern auf den individuellen Umgang mit dem Material,
der aus meiner Persönlichkeit resultiert, aus den Dingen, mit denen ich mich
beschäftige. Meine große Affinität zur Literatur und meine Arbeit als
Schauspieler fließen ein in die bildkünschtelerische Arbeit und die so
gewonnenen Erfahrungen und Einsichten wirken prägend auf das, was ich als
Schauspieler in Angriff nehme. So entstehen beispielens diese literarischen
Texte als Bildtitel, in denen ich als Regisseur, Kostümbildner, Dramenautor,
Erzähler und Schauspieler zugleich mit satirischer Distanz zur Gesellschaft der
Gegenwart Zusammengeschmiedetes inszeniere, und lustvoll aber auch zynisch,
grausam, frivol, politisch inkorrekt und hin und wieder bösartig das treibe,
was zum Beispiel Jorge Luis Borges‘ Literatur in mir freisetzte: Als
Menschenskeptiker, der ich bin, erfinde ich in beiden Berufen dialektisch unerträgliche
Situationen und krude Geschichten,
ich intrigiere mich durch die Kunstgeschichte, provoziere mit literarischen,
cineastischen, philosophischen, naturwissenschaftlichen Anspielungen und
Pointen und löcke Halbwissen. Die Bildtitel wie auch die Charaktere, die ich
auf der Bühne spiele, geben nur vor, zu erläutern oder einen Sinn zu
entschlüsseln. Realiter leiten oder verführen sie den Betrachter auf einen
falschen Weg, - der im Grunde auch kein falscher, sondern oft ein
weiterführender ist, auf welchem der nach Verstehen Suchende Vexierspielen mit
Bekanntem oder gar Verfremdungsstrategien ausgeliefert wird oder mittels
Verballhornungen oder phonetischen Assoziationen Ereignisse oder Zustände als
Wahrhaftiges in die Holzstichcollagen hineininterpretiert bekommt, was sich bei
intensiverer Betrachtung allerdings als intellektuelle Erfindung, als Narretei,
als geschickte Lüge herausstellt. "Wer nichts weiß, muss alles
glauben", formulierte Marie von Ebner-Eschenbach, und anhand dieses Axioms
boykottiere, überrolle und dämonisiere ich mit meiner Kunscht eine dem
Verdorren ethischer und moralischer Wertorientierung preisgegebene
Menschengesellschaft mit ihren banalen Profilneurosen und groteskem
Potenzgehabe schlechthin, mit ihrer technischen Hybris und ihrem als
unerbittlich inhuman sich erweisenden wissenschaftlichen Ehrgeiz. Und alles das
findet Eingang in meine Holzstichcollagen und Zeichnungen, wenn ich lustvoll
drauflosarbeite: die Gattungen bildende Kunscht, Theater, Literatur und die
Naturwissenschaften verschmelzen oder verzahnen miteinander.
Im Grunde
umreißt Folgendes das Wesen meiner Arbeit und mein Leben als Künschteler am
treffendsten: „Jemand setzt sich zur Aufgabe, die Welt abzuzeichnen. Im Laufe
der Jahre bevölkert er einen Raum mit Bildern von Provinzen, Königreichen,
Gebirgen, Buchten, Schiffen, Inseln, Fischen, Behausungen, Werkzeugen,
Gestirnen, Pferden und Personen. Kurz bevor er stirbt, entdeckt er, daß dieses
geduldige Labyrinth aus Linien das Bild seines eigenen Gesichts wiedergibt.“ (Jorge Luis Borges in „Borges und ich“)
Michael Schmidt: Du hast es
wahrscheinlich schon tausendmal berichten müssen, aber warum hast du Pickmans
Modell als Theaterstück umgesetzt? Was hat dich an der Geschichte nachhaltig
beeindruckt?
Thomas Franke: Nee, - ich erzähle
diese Geschichte zum ersten Mal. Während der Jahre, die ich die „Phantastische
Bibliothek“ mitgestaltete, schickte mir der Suhrkamp Verlag jene Bücher, die in
der Reihe erschienen waren, bevor ich die Vignetten für die Bände
gestaltete. So erhielt ich auch den Lovecraft-Band „Cthulhu
Geistergeschichten“, in welchem ich die Erzählung „Pickmans Modell“ las, die
mich vor allem deswegen beeindruckte, weil Lovecraft dem Maler Pickman Bilder
und Grafiken zuschreibt gemalt zu haben, die ich kannte: es handelte sich um
Schilderungen einiger Gemälde und Grafiken von Francisco de Goya, James Ensor,
Johann Heinrich Füssli, von Gustave Moreau und von Gustave Doré. Es konnten
also nur Pastiches sein, weswegen Pickman für mich ein Hochstapler, ein Lügner
oder ein Psychopath war; - oder konnte er sie doch gemalt haben? Anhand solcher
Überlegungen geriet ich in einen Zustand, in welchem sich die reale und die
surreale Welt wie Yin und Yang ergänzten. Wenn ich diesen Zusammenhang in die
reale Welt zu übertragen versuchte, durchdrangen das Wirkliche und das
Unwahrscheinliche einander. Eine Möglichkeit, Pickman als Persönlichkeit zu
verstehen bestand darin, daß der Erzähler an einer dissoziativen
Identitätsstörung (DIS) leidet.
Aber dann vergaß ich die Erzählung,
weil mich andere Dinge beschäftigten.
Anfang der neunziger Jahre des letzten
Jahrhunderts fragte mich der mit mir befreundete Initiator und Regisseur einer
Bonner freien Theatergruppe während eines Saufgelages, ob ich nicht Lust
verspürte, mal einen Monolog zu spielen. Ich dachte selbstverständlich sofort
an jenen Monolog, an den alle bei einer solchen Fragestellung denken: „Ein
Bericht für eine Akademie“ nach der Geschichte von Kafka. Da aber beinahe
alle Schauspieler sich an diesem Text vergriffen (und noch immer
vergreifen), verwarf ich den Gedanken, - um mich im gleichen Augenblick der
Geschichte „Pickmans Modell“ zu erinnern, die dem Kafka-Text in Duktus und dramatischem
Aufbau entspricht und also einer Beichte oder einer Selbstrechtfertigung ähnelt,
die Thurber seinem Besucher Eliot gegenüber schwadroniert, denn er war der
letzte, der Pickman begegnete. Thurber schien seine Erlebnisse und die Gemälde,
die er im geheimen Atelier des Kunschtmalers Pickman zu Gesicht bekam, nur
schwer zu verarbeiten. Ich schlug dem Regisseur vor, diesen Text als Monolog zu
spielen. Unsere erste Idee setzte einen zweiten Schauspieler mir auf der Bühne
gegenüber, dessen Aufgabe es lediglich gewesen wäre, sein Gesicht zum Gehörten
zu verziehen. Da sich kein Schauspielkollege für eine solche undankbare Aufgabe
bereit erklärt hätte, wollten wir mit der nächsten Idee ein Opfer im Publikum
dafür finden, das wir auf die Bühne mir am Tisch gegenüber zu setzen planten…
Dann jedoch hatten wir mit besoffenen Köpfen die Idee, die Inszenierung für jeweils
nur einen einzigen Zuschauenden zu erarbeiten (eine merkantil infantile
Überlegung!) und ihn wie diesen in Lovecrafts Text erwähnten Besucher namens
Eliot mir gegenüber an einen Tisch in einem Kellerraum zu setzen, wo er oder
sie das von mir Erzählte über sich ergehen lassen und das physisch sich
entwickelnde Geschehen ertragen mußte. Während der Proben zum Theaterstück
stand plötzlich der frühere Gedanke im Raum, daß der Erzähler an einer
dissoziativen Identitätsstörung (DIS) leidet. Dieses überzeugend darzustellen,
ohne daß ich mich selbst darin verlor, erwies sich als ungeheure
Herausforderung meines schauspielerischen Könnens und kitzelte meinen Ehrgeiz:
der Erzähler Thurber und der Kunschtmaler Pickman erweisen sich als zwei –
eventuell auch noch mehr – Charaktere in einer Person.
Der Beginn des Theaterstückes wurde in
den Medien folgendermaßen beschrieben: „Vor einem leeren Bilderrahmen steht im
Keller ein kahlköpfiger Mann. Stumm winkt er den zögernden Besucher zu sich,
starrt ihn lange an, wendet sich schließlich ab und raunt: „Du glaubst, ich bin
verrückt, Eliot...?“
Der bekannte Theatermacher Peter Brook
schrieb: „Ich kann jeden leeren Raum nehmen und ihn eine nackte Bühne nennen.
Ein Mann geht durch den Raum, während ihm ein anderer zusieht; das ist alles,
was zur Theaterhandlung notwendig ist.“ Ich bin noch heute erstaunt, welches
Echo die Inszenierung auch international fand. Wir nannten das Theaterstück
„Das Modell“, weil wir Lovecrafts Text nicht in jedem Detail zu folgen vermochten
und der Suhrkamp Verlag uns deswegen vorschlug, einen anderen Titel als den der
Lovecraft-Geschichte zu verwenden. Dem Regisseur Reinar Ortmann war zum einen die
Bestätigung von Peter Brooks Behauptung wichtig, zum anderen erwies sich die
Inszenierung schließlich auch als Experiment größtmöglicher Nähe im Theater, - die
übrigens nicht nur dem Zuschauer unheimlich werden konnte. Ich spielte die
Inszenierung mit mehr als 800 Vorstellungen in den gruseligsten Kellern
verschiedener Städte Deutschlands.
Im Jahr 2001 wurde das Theaterstück
schließlich mit mir verfilmt.
Vor mehreren Jahren hatte ich die
Idee, die Erzählung "Pickmans Modell" als
von mir künstlerisch gestaltetes Buch zu herauszugeben, dem die DVD mit der
Verfilmung Titels „Das Modell“ beiliegt. Ein sehr ästhetisch gestaltetes
Buch mit der amerikanischen Originalversion der Erzählung von H. P. Lovecraft,
der die deutsche Übersetzung gegenübersteht, mit den hochinteressanten
Anmerkungen von S. T. Joshi zur Erzählung, in welchen er Lovecrafts Geschichte
als aus den 1692 stattgefundenen Ereignissen der Hexenprozesse von
Salem resultierend beschreibt. Dieser Bezug läßt sich konkret aus den Namen der
Protagonisten, Thurber und Pickman, wie auch aus den Namen der weiterhin
genannten Personen herstellen, die auf unterschiedliche Weisen in diese
historisch belegbaren Vorgänge integriert waren (Quelle: H. P. Lovecraft –
The Thing on the Doorstep and Other Weird Stories, Penguin Books, 2001). Weiterhin
berichte ich in meiner Art und Weise, narrative Texte zu schreiben, über die
kausale Idee, über meine Konzeption (von der sich die endgültige Realisierung des
Theatermonologs unterschied, was ich noch immer bedauere), die sich
anschließende Arbeit am Stück mit dem Faksimile des mit meinen Anmerkungen
versehenen Textbuchs für die Probenarbeit und über die skurrilen Entdeckungen, bis
aus der Idee dieses Theaterstück und schließlich seine Verfilmung entstand. Ich
illustriere das Buch, und neben einer normalen Edition plane ich eine
Vorzugsausgabe mit beiliegendem Originaldruck einer Grafikauflage. Wie immer geht
es mir um das schön gestaltete, das bibliophile, das besondere Buch, wie ich es
zu meiner großen Freude und sehr stolz mit Arno Schmidts Roman „Die
Gelehrtenrepublik“ realisierte, das man auf dieser Internetzseite betrachten
kann:
https://shop.asku-books.com/epages/es121063.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/es121063/Products/BP-0060
(Für das geschilderte Vorhaben suche
ich noch immer nach einem Verlag, der das Projekt gemeinsam mit mir in Angriff
nimmt, nachdem es bisher trotz mehrerer Ansätze mit verschiedenen potentiellen
Partnern nicht zustande kam.)
Michael Schmidt: Du hast von 1979 bis
83 für Suhrkamp gearbeitet, aktuell machst du viel für p.machinery. Als alter
Hase, wie hat sich die Szene, die phantastische Literatur und die Buchindustrie
im Laufe dieser langen Zeit entwickelt? Ist es besser oder schlechter geworden?
Thomas Franke: Die Szene kenne ich
nicht so gut, lediglich ein paar Leute, mit denen ich zusammenarbeite,
Mitglieder von ANDYMON, vom Freundeskreis SF Leipzig, die vom Berliner
Otherland-Buchladen und so weiter und so fort. Die phantastische Literatur ist
so, wie sie immer war; die Autorinnen und Autoren hecheln wissenschaftlichen
und gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen hinterher, sie extrapolieren
zeitgeistige Themen in die Zukunft oder bemühen sich, Tolkien zu übertreffen
(zumindest die Zahl der Bände, die sie für einen Ideen-Zyklus schreiben). Jene,
die außergewöhnliche, autochthon entstandene phantastische Ideen umsetzen,
werden oft ignoriert: Georg Klein mit seinen Romanen „Die Zukunft des Mars“ und
„Miakro“ gehört beispielens dazu, Reinhard Jirgl mit „Nichts von euch auf
Erden“ (ein schwer lesbarer Roman, ich gebe es zu, doch sollte man ihn nicht
links liegenlassen), unbedingt Ror Wolfs Werk, Mircea Cartarescus Literatur…
Und das Verlagswesen? Das ist auf dem
Weg der Kommerzialisierung, auf dem Weg der
Monopolisierung der großen und mittelgroßen Verlage auf Kosten kleiner Akteure,
womit auch in diesem Wirtschaftssegment die Vielfalt verloren geht. Ursula K. Le Guin forderte
zum Beispiel in einer Rede, daß Schriftstellerinnen und Schriftsteller sich der
Freiheit erinnern und Alternativen zu einer marktgesteuerten Kultur entwerfen
müssten, die Bücher ausschließlich zu Waren degradiert. Für eine liberale Demokratie, die Pluralismus zu ihren
Grundkonstanten zählt, ist diese Art der Kommerzialisierung nach meiner Meinung
eine gefährliche Entwicklung. Eine Konzentration des Kapitals findet
statt: einigermaßen erfolgreiche Verlage werden von Medienkonzernen aufgekauft,
die sich aggressiv behaupten und viel Mist in die Buchläden einsortieren, bei
denen ebenfalls eine Konzentration zu großen Buchhandelsketten stattfindet. Vor
nicht allzu langer Zeit konnte ich noch Texte von lebenden Autorinnen und
Autoren bei Lesungen vortragen und die Verlage fühlten sich
bauchgepinselt, weil es Werbung war, die sie nicht bezahlen mußten; heute bin
ich als Vortragender gezwungen, die Verlage zu fragen, ob ich deren Texte
vortragen darf, - und wenn ich es darf, kostet mich das wegen der Urheberrechte
einen oft teuren Obolus. Na, dann lese ich doch nur noch Texte vor, deren
Verfasser und Verfasserinnen schon länger als siebzig Jahre unter der Erde
liegen. Zur letzten Vernissage meiner Bilderchen plante ich, Texte von Ror Wolf
(† 17. Februar 2020) vorzutragen, weil dieser Schriftsteller mich
außergewöhnlich beständig inspirierte. Seinen Hausverlag Schöffling & Co. grapschte
sich 2022 der Schweizer Kampa Verlag, wo man es nicht einmal für nötig
erachtete, auf meine Frage nach der Vortragserlaubnis zu antworten. Ich mußte
oft erfahren, daß die Kultur der Kommunikation nach und nach seitens größerer
Verlage und der Medienkonzerne wie auch seitens der Politikanten und
Politikantinnen zum Erliegen kam. Gegenwärtig trifft man auf Schweigen oder
wird belogen, wenn es darum geht, kausale Probleme miteinander zu lösen. Ich
erinnere mich mit Grausen meiner Bemühungen, die Rechtefrage zur Powest
„Picknick am Wegesrand“ der Brüder Strugatzki zu klären, die sich länger als
ein Jahr hinzogen und während derer ich von der Rechteverhandlungsfürstin der Verlagsgruppe
Penguin Random House (das ist Bertelsmann) durch ein kafkaeskes Labyrinth geschubst
wurde.
Was die Buchgestaltungen betrifft,
erledigen bis auf wenige Ausnahmen mittlerweile PR-Agenturen diese Arbeit mit
Bildern, die sie bei globalisierten „Stock Photography“-Agenturen kaufen. Wenn
ich nun von kleinen und mittleren Verlagen als Gestalter und Illustrator beauftragt
werde, so zahlen die oft keinen Centavo mit der Begründung, wir würden doch
alle nichts an den Büchern verdienen und wir würden doch alle an einem Strang
ziehen und trotz all dieser Umstände: schön sollten sie doch aussehen. Letzten
Endes wäre das ja auch Werbung für mich, so eine hübsche Buchgestaltung… Nun
ja, - lassen wir das.
Michael Schmidt: Viel hört man von KI und dem langsamen Sterben
der Bildkunst. Wie stehst du zu den Herausforderungen der Gegenwart und der
nahen Zukunft? Bei der Schauspielerei gab es ja auch schon Visionen,
Verstorbene zurück auf die Leinwand zu bringen.
Thomas Franke: (Ich denke, mit meinen folgenden Äußerungen werde ich
mir viele Feinde machen und denen, die es wegen meiner früheren Äußerungen über
die Kunscht-KI. schon waren, Wasser auf die Mühlen gießen, - aber: sei’s drum:)
Ich muß noch viele Jahre nicht befürchten, daß irgendeine KI. die
Holzstichcollage imitieren kann, denn es ist äußerst kompliziert und
gegenwärtig beinahe unmöglich, die feinen Holzstichlinien zu digitalisieren,
was ich immer wieder als Problem bei der Digitalisierung meiner Werke für
Buchumschlaggestaltungen einpflegen muß. Ganz zu schweigen davon, daß die Künschterliche
„Intelligenz“ daran scheitert, einzelne Motive aus einem Gesamtholzstich
herauszuschneiden und zu einem völlig neuen Bild zusammenzufügen.
Das Geschwalle über und mit der KI. ist auch nur
Geldmacherei, denn offensichtlich geht es um absichtliches Mißverstehen bzw.
Nichtverstehen kreativer Prozesse und das vorsätzliche Ignorieren von
Urheberrechten. Die Motivwelt eines bildenden Künschtelers speist sich nicht
ausschließlich aus jener seiner Vorbilder und Wahlverwandten; sie entsteht
durch das Lesen, das Hören von Musik, durch Erkenntnisse, gewonnen während
schwatzhafter Diskussionen mit anderen Spinnern, zufällig, nicht einmal bewußt Wahrgenommenes…
Ich möchte Jorge Luis Borges aus seinem Essay „Blindheit“ zitieren: „… jeder
Mensch, sollte das, was ihm zustößt, als Instrument ansehen; alle Dinge sind
ihm zu einem Zweck gegeben worden, und im Fall eines Künstlers muß dies noch
weit stärker so sein.“ Die KI. entfremdet uns von dieser Notwendigkeit des
Gebrauchens unserer künschtelerischen Begabung.
Ich habe mir zwar nie Gedanken über
Inhalte, Tendenzen oder gar über eine Philosophie hinter meiner künschtelerischen
Arbeit gemacht und auch selten darüber nachgedacht, was mich zu dieser Arbeit
treibt; ich habe all die Jahre einfach lustvoll drauflosgearbeitet. Aber wenn ich
nun kausal darüber nachdenke, was mich bewegt, während ich diese Zeichnungen,
Grafiken und später dann Holzstichcollagen erarbeite, stelle ich fest: ich
möchte etwas Geheimnisvolles, noch nie in diesem Zusammenhang Erschautes
schaffen, Bilddetails in ungewöhnliche Zusammenhänge zeichnen oder montieren,
um damit seltsame, mysteriöse Geschichten zu erzählen; ich möchte die
Betrachter mit spannenden Motiven reizen, über das Dargestellte nachzudenken
und sich selber Abenteuer aus dem zu ersinnen, was sie in meinen Werken sehen.
Denn wenn ich ein Werk anschaue oder es lese, will ich Geschichten
darinnen entdecken - und die Persönlichkeit dessen, der es schuf. Mit dem
zuletzt genannten Bedürfnis kollidiere ich immer wieder, weil bei manchen Leuten
eine Tendenz zu erkennen ist, die KI. zu vermenschlichen. Aber KI.-Erzeugnisse
sind unpersönlich und nur oberflächlich reizvoll, denn ein Prompt kann diese hier
aufgezählten und noch mehr Momente, die in ein Kunschtwerk einfließen (ich
möchte hier die Kunscht der Anschnitte, individuelles grafisches Empfinden usw.
erwähnen) nicht transportieren. Ich las einmal, „auch die neueste, heißeste Form von KI. stößt an
prinzipielle Grenzen; diese Anwendungen können – oft sogar – sehr einfache
Probleme nicht lösen. Zwar schlucken die Apps riesige Mengen an Daten, sie
finden auch statistisch wahrscheinliche Muster, aber letzten Endes schaffen sie
nur eine Art Remix des Vorhandenen. Es sind Spielereien, die mal stimmen – und
Altbekanntes wiedergeben – oder halluzinieren. Als KI. sollte man sie wirklich
nicht betrachten.“ Ein Film, in welchem eine KI-generierte Marilyn Monroe eine
Rolle gibt, zeigt lediglich ihr Äußeres und das, was die sie generierenden
Fummler von ihr denken, in sie hineininterpretieren bzw. ihr an Körperlichkeit
und schauspielerischen Aktionen pauschal unterstellen, nicht die eine Rolle
spielende Actrice Marilyn Monroe. Weil die
KI. von Menschen gemacht wird, kann sie kaum als dem Menschen überlegen
gewertet werden: ihre „intersubjektive Vergleichbarkeit“ ist wesentlich davon
abhängig, welche Menschen die KI. entwickeln und inwieweit sie die jeweilige KI.
mit eigenen Interessen konstruieren. Mit der Kunscht-KI. werden also mittelmäßige Bilder und mittelmäßige Texte generiert,
ganz zu schweigen von der mittelmäßigen Musicke die mittlerweile Spotify
überschwemmt, - und die kurzen zeitlupigen Clips präsentieren ebenfalls nichts,
was mich fasziniert. Nach fünf oder sechs solchen Aneinanderreihungen von
kurzen Sequenzen, die in phantastischen Filmen wahrscheinlich besser aufgehoben
wären, beginnt mich das zu Sehende zu langweilen.
Des
Weiteren ist es Diebstahl geistigen Eigentums, der erforderlich war, um die
Modelle zu „trainieren“ (es handelt sich schlicht um faktisches
Kombinieren einprogrammierter Werke, nicht um autochthone schöpferische Qual). Milliardenschwere Tech-Konzerne wie OpenAI und Meta stehlen
urheberrechtlich geschützte Daten (Texte, Bilder, Musik, etc.) und „trainieren“
damit ihre KI., ohne die Urheber
und Urheberinnen zu fragen, - geschweige denn, sie zu vergüten. Die gesammelten
Daten werden schließlich verwendet, um Buchcover, Songs oder eben Übersetzungen
mit Mausklicks zu erstellen. Das ist natürlich billiger als echte Menschen für
wirklich kreative Arbeit zu vergüten. Es ist aber vor allem kurzsichtig: Denn
damit entziehen sie der Unterhaltungskunscht die Lebensgrundlage und schaffen
sie allmählich ab. Die Kunscht ähnelt auf diese
Weise Fast Food; richtig Kochen ist aufwendig, schmeckt und nährt allerdings
auch ganz anders. Deswegen wird es weiterhin die menschengemachte Kunscht
geben. Kunscht ist nicht nur für die Konsumenten gemacht, sondern weil viele
Machende von einem inneren Zwang getrieben werden, sich zu äußern. Als ich noch
studierte – damals, vor Jahrtausenden – unterschieden wir zwischen Kunst und
Gebrauchskunst (ergo: angewandte Kunst). Was letztere bedeutet, können
Interessierte bei WIKIPEDIA nachlesen.
Wahrscheinlich wird der KI. als künschtelerisches
Spielzeug eine ähnliche Zukunft bevorstehen wie vielen Modeerscheinungen. Das
ist wie beim
Pornos-Schauen: man stumpft ab, das Erleben eines „sense of wonder“ verliert sich.
Ich hoffe, daß es auch bald konsumierende KIs gibt, die sich den mittelmäßigen
bis unerträglich schlechten, kitschigen KI.-Kunscht-Kram reinziehen und ihn zu
kaufen imstande sind, denn die Tech-Konzerne wollen letzten Endes Profit
generieren.
Michael Schmidt: Jeschke, Franke, die
sind ja schon tot. Du lebst und kannst nach vorne aber auch zurück blicken. Wie
würdest du dein Vermächtnis definieren? Was hat die Welt durch Thomas Franke
erfahren?
Thomas
Franke: … hm… Die Welt hat durch mich wahrscheinlich nichts erfahren. Aber der
Thomas Franke kroch einige Jahre lang als Würmchen über ihre Oberfläche,
welches durchgefüttert und intellektuell ruhig gestellt werden mußte. Einige
andere Würmchen auf dieser Welt hatten Spaß mit mir – und auch durch mich, … also:
aufgrund meiner Arbeit, daß ich ein paar hübsche Bücher schuf und als
schauspielernde Charge über die Bretter hüpfte, welche nach Shakespeare wohl
angeblich die Welt bedeuten. Diesbezüglich kommt mir in den Sinn, ob mein Werdegang mitsamt den Zufällen, die
ihn auslösten, nicht augenscheinlich ein schicksalhafter zu nennen ist? Der
Weltbürger, Schriftsteller und Philosoph Jean Gebser sagte einstmals, alles was
uns widerfahre, sei nur eine Antwort oder ein Echo auf das, was wir wären. Mag
sein, er hatte Recht?
Warum habe
ich mich dann für einen solchen und nicht den Lebensweg als Physiker oder
Politiker (ich wurde 1983 wirklich ernsthaft gefragt, ob ich als Abgeordneter
der Liberaldemokratischen Partei Deutschlands [LDPD], deren Mitglied ich damals
war, in die DDR-Volkskammer einrücken wollte) entschieden, auf dem ich sicher
mehr hätte bewirken und als Vermächtnis hinterlassen können? Oh je, - das war
für mich nicht die Frage einer Entscheidung; ich konnte diesem unbedeutenden, für
das System unrelevanten Künschtelertum einfach nicht entgehen: mit so vielen
Talenten gequält, mit so viel Neugier bestraft und mit so vielen Bildern vor
dem inneren Auge, mit all diesen Erkenntnissen, Verletzlichkeiten,
erschreckenden Erlebnissen. Als Künschteler leben zu müssen, ergibt sich wohl
aus der Entwicklung meiner Persönlichkeit, meiner Ansichten und Meinungen gegenüber
der Welt sowie meinem leisen Vorhandensein in dieser Gesellschaft. Solche
Überlegungen führe ich mir immer wieder vor Augen, um die mir wertvollen ethisch-moralischen Grundsätze und meinen
Gestaltungs- und Lebenshunger nicht aufgeben zu müssen. Und diese Einstellung
preßte mich halt vermittels dialektischer Wechselwirkungen zu einem Sonderling,
der am Rande dieser Gesellschaft dahinlebt, worauf ich nicht stolz bin.
Deswegen will ich niemand anderem empfehlen, diesen Weg zu gehen.
Michael Schmidt: Der Poetry-Slam. Ein
Quantensprung oder ein überflüssiges Format?
Thomas Franke: Dieses
Veranstaltungskonzept kenne sowohl als Vortragender wie auch als Zuschauer.
Poetry-Slams sind reine Unterhaltung, die an der Basis der Wettbewerbe
eigentlich darauf bauen, wie viele Leute aus der Verwandtschaft der oder die
Vortragende bewegen kann, am Abend des Vortrags bei der Abstimmung eine Hand
mit Abstimmungskärtchen oder Blümchen hochzurecken. Aber wie ich eingangs
bemerkte: ich trinke lieber ein paar Gläser Bier. (Ach ja, ich empfehle meinen
Reimling sich zu Herzen zu nehmen: Mein erstes Gedicht…………., / ich schreib‘s
besser nicht.)
Michael Schmidt: Kunst und Kommerz.
Siehst du Wege, beidem gerecht zu werden, ohne sich zu verleugnen?
Thomas Franke: Nein, man kann nicht
beidem gerecht werden, weil diese merkantil und lediglich am Profit einiger
weniger Menschen orientierte Gesellschaft, weil die unterschiedliche Gewichtung
von Kunscht und Kommerz unter diesen kapitalistischen Bedingungen, unter denen
alles, selbst Geistiges, zur Ware verkommt, sich aus diesen Gründen nicht
vermeiden läßt. Der Schauspieler Ulrich Mühe – er kam ebenfalls aus der DDR,
war schon dort um einiges opportunistischer als ich und deswegen schließlich im
Westen Deutschlands merkantil erfolgreicher – sagte einstmals in einem
SPIEGEL-Interview, auch in dieser, der westlichen Gesellschaft könne man mit
außergewöhnlicher Begabung nicht umgehen. Tja, der Kollege hatte Recht, -
ansonsten konnten wir einander nicht leiden (auch zu Recht) und wahrscheinlich
peinigen sie ihn jetzt in der profanen Hölle mit blödsinnigem analytischem
Geschwätze und damit, daß sie ihm Seele für Seele das Leben einer Anderen vor
die Augen führen. Ja: dieses Bild gefällt mir!
Ich machte die Erfahrung, daß Ruhm oft
erst dann einsetzt, wenn der Mensch sich und seine ethisch-moralischen
Grundsätze aufgibt und sich zum Narren macht; wenn er dann berühmt ist,
verdient er viel Geld, muß allerdings weiterhin den Narren geben. Ausnahmen
bestätigen die Regel.
Lange Jahre hatte ich beispielens gedacht, die „Phantastische
Bibliothek“ des Suhrkamp Verlags wäre eine kommerziell einträgliche Buchreihe,
bis ich dann in einem Artikel von Franz Rottensteiner las - der Herausgeber
dieser Buchreihe -, daß viele Ausgaben sich kaum verkaufen ließen und die
„Phantastische Bibliothek“ hauptsächlich getragen wurde von Lovecraft-, Lem-,
Dick-Büchern und den Sammelbänden. Aber die Buchreihe, immerhin edierte sie der
Suhrkamp Verlag, war ein Prestigeobjekt – und ein solches auch für mich als
Buchgestalter, denn wenn ich noch einmal Wolfgang Jeschke zitieren darf: „…Bis
ich Ende der Siebzigerjahre auf Werke von Thomas Franke stieß. Ich war zu jener
Zeit Herausgeber der Science Fiction-Reihe des Heyne Verlags und beneidete die
Suhrkamp-Herausgeber mit einem so hervorragenden Coverkünstler zu punkten.
Aber natürlich war mir klar, dass er mit dem Heyne-Image nicht
kompatibel war: Viel zu intellektuell, zu künstlerisch, zu wenig Farbe, zu
wenig Action. Und zehn bis zwölf Neuerscheinungen monatlich mussten gestaltet
werden. Man hätte eine neue schmale, hochkarätige Reihe erstklassiger Science
Fiction starten müssen, aber das wagte ich gar nicht erst vorzuschlagen. Die
saturierten Vertreter hätten so ein Projekt mit ihren dicken Patschhändchen
sofort vom Tisch gewischt; diesen Banausen war mancher Coverentwurf des
markterfahrenen Karel Thole schon zu abstrakt und unverständlich und das so
gestaltete Buch galt ihnen als unverkäuflich. Ein aussichtsloses Unterfangen
also.“
Watt else sollen isch noch da derzu sagen?
Michael Schmidt: Was würdest du, mit
all deiner Erfahrung, jungen Kreativen mit auf den Weg geben?
Thomas Franke: Keine Ratschläge, weil
die immer nach Pädagogik riechen. Jeder Kreativende muß seinen Weg für sich
selber finden, jedoch sollte das Lebensziel nicht das Streben nach Geld und
Ruhm sein oder, schauspielernd, die pragmatisch-pubertäre Einstellung, die Welt
teilhaben lassen zu wollen an der eigenen Seele oder den als wichtig
empfundenen Emotionen. Das eine korrumpiert, das andere ist dumm. Ich bin zum
Beispiel auch sehr vorsichtig, mich selbst als „Künstler“ zu bezeichnen, weil
ich das eventuell nicht bin. Deswegen bezeichne ich mich und alle jene, die
sich heutzutage das kreative Dasein mit existentiellem Darben, mit Demütigungen,
Erniedrigungen und Außenseitertum, Aussätzigen vergleichbar, erkämpfen, als
„Künschteler“, weil dieses Wort ironisch, poetisch und witzig klingt und auch
sprachassoziativ die Armut intendiert, mit welcher sie sich durchschleckern.
Künschteler werden übrigens nach ihrem Tod in die Ewigen Künschteler-Gründe
eingehen, wo ihnen halt das ewige Künschtelerglück winket, verstanden? Es
handelt sich dabei um eine Art Arkadien, denn das steht uns unbedingt zu! Dort
warten schon, um einen Biertisch versammelt, Hieronymus Bosch, Altdorfer, Max
Ernst, Goya, Arno Schmidt, Arkadi und Boris Strugatzki und einige andere auf
mich.
Michael Schmidt: Noch ein Wort an die
Meute dort draußen!
Thomas Franke: Ich zolle allen denen,
die sich bis hierher durch mein G’schwätzle gearbeitet haben, meine große
Achtung. Zudem rate ich allen, sich nicht in einen dritten Weltkrieg treiben zu
lassen.





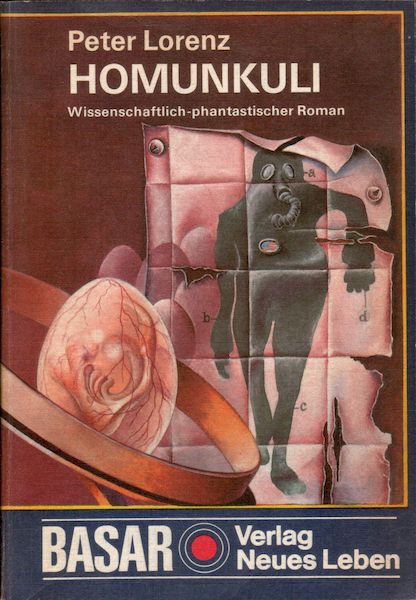
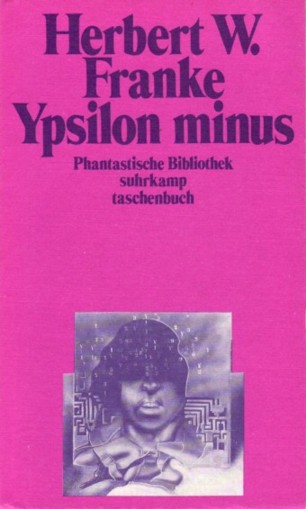
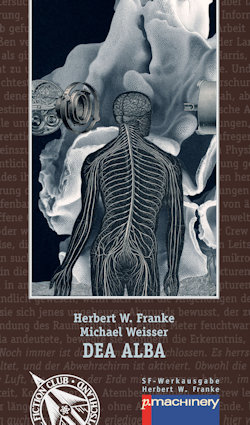





Kommentare
Kommentar veröffentlichen